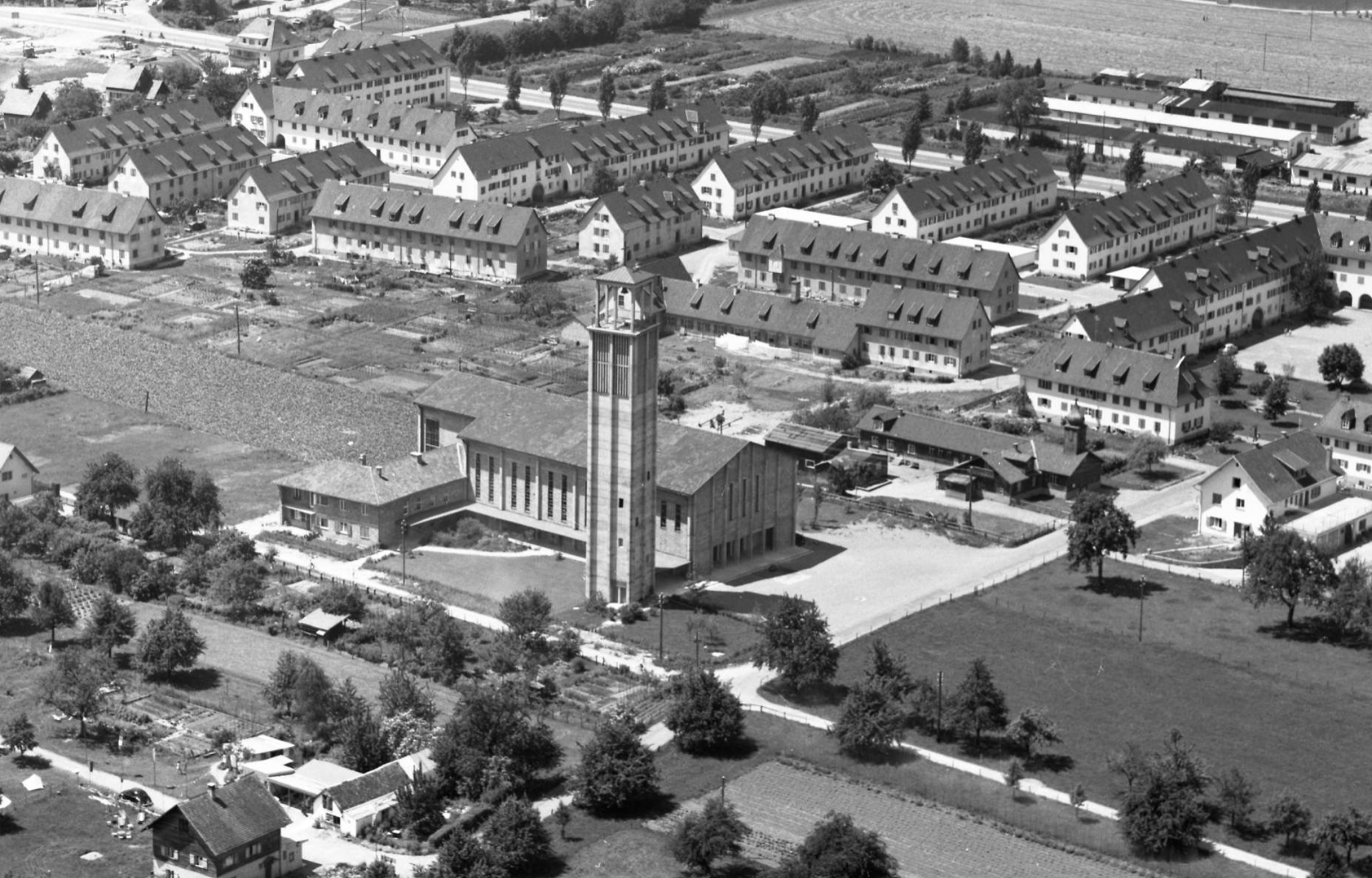Ein Hund kam in die Küche
und stahl dem Koch ein Ei.
Da nahm der Koch den Löffel
und schlug den Hund zu Brei.
Sepp Mall erzählt in seinem Roman „Ein Hund kam in die Küche“ aus der Sicht eines 11-jährigen Kindes, wie sehr die so genannte „Option“ ab 1939 die Südtiroler Bevölkerung gespaltet und gequält hat.
Wie kam es dazu? Das Leben war für die Südtiroler Bevölkerung nach dem Ersten Weltkrieg noch schwieriger geworden. Die immer stärker werdenden Faschisten wollten den Südtirolern mit brutaler Gewalt alles Österreichisch-Deutsche austreiben. Zu diesem Zweck präsentierte der Trentiner Faschist Ettore Tolomei einen umfangreichen Maßnahmenkatalog, der den Anfang eines beispiellosen Terrors darstellte, dem die überwiegend bäuerliche Bevölkerung des Landes nun über Jahrzehnte ausgesetzt war.
So wurden u.a. sämtliche Ortsbezeichnungen in Südtirol italianisiert, Italienisch wurde zur alleinigen Amtssprache erklärt, die Südtiroler Kinder erhielten ihren Unterricht nur mehr auf Italienisch und wurden bestraft, wenn sie Deutsch sprachen, selbst im Kindergarten war Deutsch verboten und auch die Vornamen und manche Nachnamen der Bevölkerung wurden italianisiert.
Ähnlich wie die Briten damals die irische Bevölkerung drangsalierten, wollte Mussolini 1939 mit dem faschistischen Terror die Südtiroler Bevölkerung dazu zwingen, entweder ihre Wurzeln und ihre Identität vollkommen preiszugeben oder ins Dritte Reich auszuwandern.
Der zynische Begriff „Option“ bezeichnet somit die „Wahlmöglichkeit“, sich entweder für einen Verbleib im faschistischen Italien oder für die Auswanderung ins Hitler-Reich zu entscheiden, eine Wahl zwischen Pest oder Cholera.
Ein Großteil der Bevölkerung entschied sich letztlich für die Deutschland-Option. Doch lediglich 75.000 Südtiroler wanderten tatsächlich aus, wo auf die Familien allerdings nicht die versprochenen Häuser und Bauernhöfe warteten, sondern Notquartiere und kleine Wohnungen und wo die Männer im wehrfähigen Alter in der Wehrmacht Kriegsdienst leisten mussten. Rund 25.000 kehrten nach Kriegsende nach Südtirol zurück, wo sie nach dem Ende des faschistischen Regimes eine Gleichstellung der Sprache, weitgehende kulturelle Freiheiten und ein gewisses Maß an Autonomie geboten bekamen.
Der Leser erlebt aus der Sicht eines Kindes die schwierige Entscheidung der Eltern, entweder alles aufzugeben und nach Nazi-Deutschland auszuwandern oder in einem Staat zu bleiben, in dem man nicht willkommen und den ärgsten Repressalien ausgesetzt ist. Erst nach langem Zögern entscheiden sich die Eltern Ludis im Jahr 1942, ihr kleines Dorf zu verlassen und ins „Reich“ auszuwandern.
Der 11-Jährige erzählt zu Beginn des Romans von den letzten Tagen im – fiktiven -Dorf, wie er sich bemüht, in seiner Erinnerung alles Schöne und Vertraute zu speichern, sich zum letzten Mal mit seiner Schulfreundin Kathrina trifft und wie er über das mit Hakenkreuzen beflaggte Innsbruck staunt. Von dort wird sein behinderter Bruder Hanno in die Heil- und Pflegeanstalt in Hall in Tirol gebracht, während Ludi und seine Eltern nach Oberösterreich fahren und dort in einer kleinen Wohnung in einem bäuerlichen Umfeld leben müssen. Der Vater, der die Ausreise befürwortet hatte, muss bald als Soldat an die Front, zunächst nach Frankreich, dann nach Russland.
In seiner Vorstellung unterhält sich Ludi weiterhin mit Hanno und ahnt nicht, dass sein Bruder, zu dem die Familie keinen Kontakt mehr bekommt, inzwischen in einem Heim im Allgäu verstorben ist – bis seine Mutter den Brief des Anstaltarztes aus Kaufbeuren mit der Todesnachricht bekommt.
Der imaginäre Bruder erscheint Ludi stets, wenn er allein ist, und unterhält sich mit ihm. Auch als seine Mutter und er den Gau Oberdonau verlassen und in die Nähe von Landeck ziehen, sieht der mittlerweile 14-Jährige seinen Bruder Hanno. Häufig trifft sich Ludi gegen Kriegsende auch mit der Sudetendeutschen Ingrid, ein Mädchen, das mit seiner Mutter aus Pommerland geflüchtet ist und einmal das Lied „Ein Hund kam in die Küche“ singt. Ingrid versteht Ludi, als er ihr von seinen Unterhaltungen mit Hanno erzählt, denn sie unterhält sich auch immer wieder mit ihrem toten Vater.
Seine Mutter und überqueren dann illegal die Grenze nach Italien und kommen bei Verwandten in Meran unter. Nach einigen Monaten gibt es ein Wiedersehen mit dem aus der Gefangenschaft entlassenen Vater, dem wie vielen anderen die Kriegserfahrungen schwer zu schaffen machen, denn die Wehrmachtsoldaten hätten sich in Russland „in den Dörfern aufgeführt wie von Sinnen“.
Für die Menschen im Land, die geblieben waren, sind nun die Heimkehrer jene, auf die sie hinabschauen, die „Hitler nachgelaufen sind“ und die Heimat verraten hatten. Nichtsdestotrotz ist seine Mutter froh, wieder in ihrer Heimat, bei ihren Wurzeln zu sein, obwohl nichts mehr wie früher ist.
Sepp Mall schildert in seinem Roman die Traumata, die einer Südtiroler Familie widerfahren, weil sich die Eltern in der „Option“ für die Ausreise ins Deutsche Reich entscheiden und sich alle Versprechungen als leer erweisen. Der Preis, den die Familie für die Entscheidung zahlen muss, war sehr hoch.