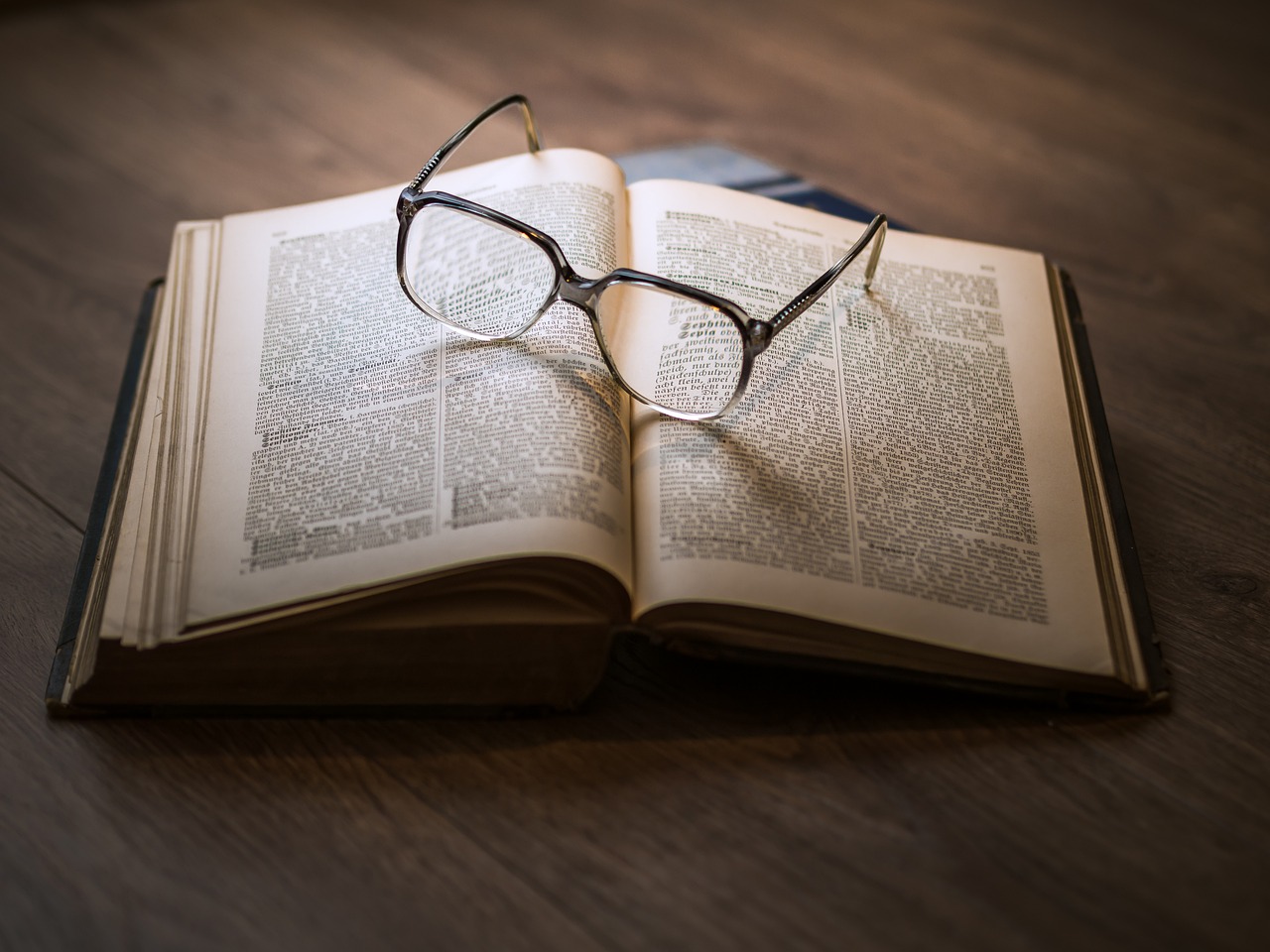(Bildquelle: Charlie Chaplin: Modern Times, Wikipedia, Public Domain)
Über die Zukunft der Schule wird seit Jahrzehnten intensiv diskutiert und noch mehr gestritten. Manches im österreichischen Schulsystem wurde ja auch geändert, doch letztlich gab es nie eine Reform, die diesen Namen wirklich verdient hätte, sondern höchstens das eine oder andere “Reförmchen”. Warum ist das so? Da gibt es zum einen die Bildungsexpertinnen und -experten und ihre Vorstellungen von einer Reform. PolitikerInnen haben – vor allem gegen Ende einer Legislaturperiode – wiederum meist andere Pläne, die sich oft nicht daran orientieren, was die Schule heute wirklich brauchen würde, sondern daran, was ihre potenziellen Wählerinnen und Wähler präferieren. Und dann spielt meist auch noch die Grundhaltung der Gewerkschaft eine besondere Rolle, die man vorsichtig als „systembewahrend“ bezeichnen könnte. Das Thema Bildungsreform ist daher ein heißes Eisen und die allgemeine Situation ist durch die Diskussion, was nun gut für „links“ oder „rechts“ sein könnte, ziemlich verfahren. Denn letztlich reden dabei – ähnlich wie beim Fußball – sehr viele selbsternannte Expertinnen und Experten mit, deren Meinungen sich nicht selten gravierend von denen der Fachleute unterscheiden. Die Situation ist also verzwickt.Wenn Sie sich aber dafür interessieren, was sich 11 renommierte Expertinnen und Experten von der Schule des Jahres 2030 erhoffen, lesen Sie das im August 2017 erschienene Buch “Bildung 2030”, das Olaf-Axel Burow und Charlotte Gallenkamp von der Universität Kassel herausgegeben haben!
Das Werk weist ein ausgesprochen detailliertes Vorwort auf, in dem Herausgeber Burow die einzelnen Beiträge vorstellt. Im Nachwort nimmt er noch einmal kritisch Stellung zu den Artikeln, die teilweise aus sehr unterschiedlichen Perspektiven verfasst sind. In seiner Einleitung erinnert Burow zunächst an seine eigenen “radikalen” Vorstellungen von einer guten Schule, die er bereits 1981 als junger Lehrer publiziert hatte. So forderte er damals pädagogisch gescheite Dinge wie „selbstgesteuertes Lernen und Kreativität“, „Lernen nicht in Stunden, sondern in sinnvollen Ganzheiten“, die „Förderung von physischem Lernen“ und „selbstbestimmtes Lernen“. Burow muss aber heute resigniert eingestehen, dass sich das Bildungswesen in den 36 Jahren seither nicht wesentlich geändert habe. Noch immer, betont Burow, sei „Schule nach dem Modell der Fabrik der industriellen Massenproduktion und dem ständischen System Preußens organisiert”, das sich durch harte Selektion auszeichnete. Denn wer nicht in der Lage ist entsprechend mitzuhalten, muss den Klassenverband verlassen und das Jahr wiederholen – ungeachtet der Tatsache, dass inzwischen mehrere Studien belegen, dass “Sitzenbleiben” selten etwas bringt, sondern nur sehr viel Geld kostet.
Wir investieren in die Technik und alles wird gut?
Wie so oft, wenn es um die Zukunft der Bildung geht, melden sich auch in diesem Werk mehrere technikbegeisterte Fachleute (zu denen auch der Herausgeber gehört) zu Wort, die die seit mehr als 20 Jahren gehörten Aussagen vertreten, dass es die digitalen Medien seien, die einen Paradigmenwechsel bedingen, da wir als Angehörige der Wissensgesellschaft wegen der Digitalisierung “Lerncoaches” und “Regisseure” brauchen und dass Tablets die Schulbücher “in absehbarer Zeit” verdrängen würden usw. Klar: es ist unerlässlich, dass sich in Europa Politik und Wirtschaft intensiv mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Doch andererseits ist es pure Spekulation, ob unsere Kinder später im Leben dann einen Riesenvorteil haben werden, wenn wir sie ab der Volksschule andauernd mit der neuesten Hard- und Software beschäftigen.
Mythos e-Book
Es ist mehr als fraglich, ob mittelfristig das e-Book das traditionelle Schulbuch verdrängen wird. Das analoge Schulbuch wird es sicherlich so lange geben, bis die Verlage ein Modell entwickelt haben, das ihnen ermöglicht, mit dem Verkauf von e-books gleich viel zu verdienen wie mit ihren Druckwerken bisher. Wobei hier noch zu diskutieren wäre, welche Kriterien überhaupt ein gutes e-Book für die Schule ausmachen… Auch diese Entwicklung dürfte sicherlich nicht bis 2030 abgeschlossen sein, sondern – falls sie überhaupt kommt – zumindest noch mehrere Jahrzehnte dauern.
Pamela Bogdanov stellt in ihrem Beitrag gar die Frage, „ob es Lehrkräfte in der Zukunft noch geben wird oder ob Lernprozesse nur noch selbstgesteuert auf digitaler Ebene stattfinden werden.“ Es ist schön, wenn es Menschen gibt, die an das Positive in uns glauben und an die Fähigkeit, dass wir so sehr motivierbar sein können, um allein über einen PC Kompetenzen und Wissen zu erwerben. Es mag ja vereinzelt Menschen geben, die es schaffen, sich ohne jede direkte soziale Interaktion mit anderen nur über eine Maschine über ein Lernprogramm oder durch die Teilnahme an einem „MOOC“ etc. erfolgreich weiterzubilden. Die meisten Zeitgenossen dürften aber ein Lernen mittels selbstgesteuerter Lernprozesse, die ohne Begleitung nur auf der digitalen Ebene stattfinden, als sehr mühselig und auch uninteressant empfinden und letztlich daran scheitern.
Ein anderer Autor, der Schulleiter Martin Fugmann, hat Sorge, dass wegen der fortschreitenden Digitalisierung „deutsche Schüler den Anschluss verlieren“, und glaubt zu wissen, dass die „überfällige Ausstattung deutscher Schulen mit digitaler Zukunftstechnologie nach einem Paradigmenwechsel verlange“. Es geht ihm also offenbar nicht darum, Unterrichts- und Schulentwicklung zu fördern, weil sich die Gesellschaft geändert hat und die starren Strukturen unseres Schulsystems überholt sind, sondern weil wir die Schulen endlich mit Hard- und Software ausstatten und diese entsprechend zeitgemäß einsetzen sollen. Zäumt hier jemand denn ein Pferd von hinten auf?
Es sind gewiss nicht die Medien, also die Lehrmittel, die wir als Ursache dafür festmachen sollten, dass die traditionelle Schule reformbedürftig ist. Vielmehr sind es wesentliche gesellschaftliche Veränderungen, die in den letzten Jahrzehnten um sich gegriffen haben und deren Auswirkungen immer mehr Druck auf unsere träge und änderungsresistente Bildungslandschaft erzeugen.
Ökonomisierung der Bildung
Jürgen Overhoff befasst sich in seinem Beitrag mit dem massiven Druck, den die neoliberale Ideologie auf unser Bildungssystem ausübt, denn heute ist Bildung zur Ware geworden und anders als früher kein Selbstzweck mehr. Unser “ökonomisiertes Verständnis” von Bildung reduziert die Schule auf einen Ort, der Kinder und Jugendliche primär auf die Erfordernisse der Wirtschaft vorzubereiten hat. Bildung in diesem Sinne ist Vorbereitung für den beruflichen Wettbewerb und nicht mehr Herzens- und Charakterbildung. Einen möglichen Ausweg aus der Situation sieht Overhoff darin, dass wir uns auf das Bildungsverständnis der Philosophen der Aufklärung (Locke, Kant, Humboldt) zurückbesinnen und bei den Kindern und Jugendlichen vor allem Wissbegierde und Lust am Lernen fördern, damit sie das Glück beim Lernen erfahren dürfen.
Stärkenorientiert arbeiten
Charlotte Gallenkamp beschreibt in ihrem Text das Potenzial der „Positiven Pädagogik“. Wir dürfen nicht länger unser Augenmerk vor allem auf die Schwächen unserer Schülerinnen und Schüler legen, sondern müssen Fehler als Chancen begreifen. Letzlich, so Gallenkamp, gehe es darum, Kinder und Jugendliche zu stärken und den Focus auf ihre Stärken zu legen. Wie der Neurobiologe Gerald Hüther vertritt auch sie die Ansicht, dass weniger mehr ist, und plädiert für eine Reduktion der Lehrplaninhalte.
Teilhabe in der Schule fördern
Auch Hans Peter Kuhn sucht nicht das vermeintliche Heil in der Digitalisierung der Bildungslandschaft, sondern empfiehlt, neue Strukturen zu entwickeln und diese in Ganztagsschulen zu leben. Kuhn fordert, Ganztagsschulen flächendeckend anzubieten, in denen “Unterricht und außerunterrichtliche Angebote gleichmäßig über den ganzen Tag verteilt” sind und ausreichend Zeit für Projektarbeit vorhanden ist. Eine gute Ganztagsschule ist jene, die “ihre Ziele und ihr Programm so formuliert, dass die Nutzung der Potenziale einer ganztägigen Organisation klar erkennbar sind” und “alle Lehrkräfte – zumindest konzeptionell – mitarbeiten. Die Schule des Jahres 2030 muss deutlich besser sein und vor allem dazu beitragen, herkunftsbedingte Bildungsungleichheiten abzubauen und so zu mehr Chancengleichheit führen. „Dabei liegt ihr Potenzial vorrangig im Abbau primärer Herkunftseffekte, kann aber auch im Rahmen einer verbesserten Elternarbeit zum Abbau sekundärer Herkunftseffekte beitragen.“
Olaf-Axel Burow und Charlotte Gallenkamp haben ein Buch mit spannenden Beiträgen zusammengestellt, dessen Lektüre anregt, informativ ist und manchmal aber auch zum Widerspruch reizt. Was durchaus gut ist, denn es ist ja nichts langweiliger, als sich ständig in seiner eigenen kleinen „Blase“ aufzuhalten und mit Dingen konfrontiert zu werden, die bei einem lediglich ein Kopfnicken verursachen.
Die Daten zum Buch:
Burow, O. and Gallenkamp, C. (2017). Bildung 2030 – Sieben Trends, die die Bildung revolutionieren. Beltz. Weinheim. ISBN:978-3-407-25760-4